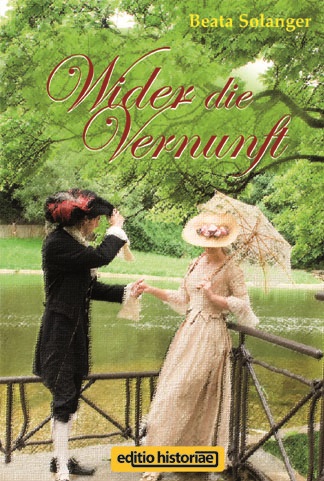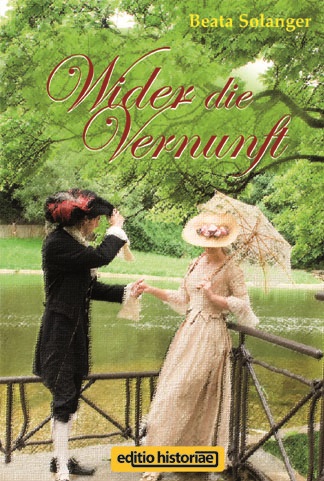Alexander Sixtus von
Eisenhardt deckte seine Patientin
liebevoll zu. Endlich war das Fieber gesunken.
Der Herzschlag war schwach,aber stetig.
Erleichtert legte er das Hörrohr in seine Ledertasche. Mit
einem Seufzer strich er sich über seine brennenden
Augen – den säuerlichen Geruch seiner
Hände ignorierte er. Der Mediziner hatte die ganze Nacht
über die hoch fiebernde Frau gewacht und ihr in
regelmäßigen Abständen Laudanum
verabreicht.
Ohne Unterlass hatte
er die Leinenbinden an ihren
Füßen abgenommen, in kaltem Essigwasser
gespült und
wieder vorsichtig um die mageren Glieder geschlungen.
Erschöpft
blies er die Luft aus. Ein Geräusch an der Tür
ließ ihn aufsehen. Die schwer gezeichnete Mutter der jungen Patientin
blickte Alexander müde an. Mit einem leichten
Nicken signalisierte er ihr, dass das Schlimmste überstanden
war. Sein Gegenüber schloss die Augen. Im
blassen Schein der Kerze war zu erkennen, dass sich die Lippen
der alten Frau bewegten – ein
Dankgebet an den Herrn, dass er das Leben der Tochter diese Nacht
noch einmal verschont hatte.
Mit zitternden
Händen hielt sie ihm eine Schale frisches Wasser hin. Der
junge Arzt nahm die Waschmöglichkeit dankbar entgegen und
griff nach einer Spezialseife, die er ständig bei sich trug.
Aufmerksam wusch er sich die Hände und das Gesicht. Einmal und
noch einmal – er sollte bei seinen nächsten
Patienten kein Krankheitsherd sein. Alexander fischte nach einem
ausgekochten Leinentuch, das in einem Seitenfach seiner
Behandlungstasche steckte. Später wollte er es durch ein
frisches Wäschestück ersetzen. Mit einem letzten
Blick auf seine tief schlafende Patientin verließ der Arzt
das Krankenlager. So leise wie möglich schloss er die schlecht
eingehängte, fürchterlich knarrende
Türe.
Die ärmlich
gekleidete Mutter hatte auf ihn gewartet und führte ihn einen
muffigen Gang entlang, der in einem Raum endete, der als Vorraum,
Küche, Ess- und Wohnzimmer der Familie diente. In der Eile am
Vorabend war Alexander der Weg nicht aufgefallen. Frau Brugg hatte ihn
regelrechtzum Krankenlager gezerrt – panisch vor Angst vor
dem besorgniserregenden Zustand ihrer Tochter. Auch jetzt schenkte
Alexander der Behausung so wenig Beachtung wie möglich
– er konnte es nicht, denn die Armut dieser Menschen war
bedrückend. Auf dem Tisch lagen zwei Münzen bereit.
Diese Bezahlung würde nicht einmal die Kosten für das
verabreichte Laudanum decken, doch Alexander wusste, dass diese Frau
ohnehin alles gab, was sie hatte. Hätte die verzweifelte
Mutter ihre Tochter in die Räume des
Soldatenspitals vor den Toren Wiens gebracht, wäre der Preis
für die Behandlung zehn Kreuzer gewesen. Doch nur bei
tatsächlich nachgewiesener Bedürftigkeit.
Wohlhabendere
Patienten wurden um einen halben Gulden erleichtert, wenn sie in den
Genuss ärztlicher
Zuwendung kommen wollten.
Die Stimme von
Eleonoras Mutter war nur ein Flüstern. „Bitte,
lassen Sie mich zumindest eine Suppe für Sie
richten.“ Unsicher legte sie ihre raue, von der
täglichen schweren Arbeit gezeichnete Hand auf Alexanders
Unterarm. Der Arzt neigte seinen Kopf. „Haben Sie Dank, Frau
Brugg, das ist mir sehr willkommen.“ Er unterstrich sein
Einverständnis mit einem Lächeln.
Die Mutter seiner
Patientin nickte zufrieden und zeigte auf einen Holzschemel, der nicht
den Eindruck machte, als würde er das Gewicht eines
erwachsenen Mannes noch tragen können. Mit großem
Respekt nahm Alexander Platz. Er war zwar schlank - das Gefühl
des Hungers kannte auch er - aber recht groß.
„Für
ihre Tochter wird eine kräftigende Brühe auch das
Richtige sein.“ Damit hielt er seine Gastgeberin davon ab, zu
großzügig in eine Holzschale einzuschenken.
Mit leicht
zitternden Händen stellte die alte Frau die Suppe vor
Alexander ab. Der Geruch verriet, dass kräftig die letzte
Bezeichnung war, die das Gebräu verdient hätte, doch
seinem leeren Magen sollte das dünne farbige Wasser vorerst
reichen.
„Nein,
vielen Dank.“ Mit einer schwachen Handbewegung lehnte der
Mediziner das angebotene Brot ab und tat sich an der Suppe
gütlich. Über den Schalenrand beobachtete er die
leidgeprüfte Mutter. Zusammengesunken saß sie ihm
gegenüber auf einem anderen Schemel und starrte meist ins
Leere.
„Eleonora
ist das letzte Kind, das mir geblieben ist.“, sie sprach so
leise, dass Alexander sie fast nicht verstehen konnte.
Ohne aufzublicken,
fuhr sie fort.„Die anderen Mädchen haben die Pocken
erwischt und meine beiden Söhne sind in Freiberg
gefallen.“
Die Traurigkeit in
der Stimme der Frau schnürte Alexander die Kehle ab. Beklommen
dachte er an die grauenvolle Schlacht, die dem Siebenjährigen
Krieg endlich ein Ende gesetzt hatte. Er spürte, wie ihm eine
Gänsehaut über den ganzen Körper lief. Es
konnte gut sein, dass einer dieser Söhne unter seinen
Händen gestorben war, während er verzweifelt versucht
hatte, den Soldaten zu retten. Doch die meisten waren schon halbtot
gewesen, als sie von ihren – meistens auch schwer
verwundeten - Kameraden ins Sanitätszelt geschleppt worden
waren. Alexander war auch klar, dass Eleonoras Mutter nur die Kinder
erwähnte, die das Säuglingsalter oder zumindest die
ersten paar Jahre überlebt hatten. Er dachte an seine eigenen
Geschwister. Seinen jüngerer Bruder Christian und seine beiden
Schwestern, die Nesthäkchen der Familie – doch auch
dazwischen hatte es drei Kinder gegeben, die das erste Lebensjahrzehnt
nicht erreicht hatten.
Der junge Mann
seufzte. „Bitte lassen Sie es mich sofort wissen, wenn sich
der Zustand von Eleonora wieder verschlechtern sollte.“ Er
erhob sich. „Ich werde unverzüglich
kommen.“
Das Geld lag immer
noch auf dem Tisch. Alexander strich seine Weste glatt, zog sich seine
Jacke an und griff nach seiner schwarzen Ledertasche. Schon wollte er
sich Richtung Ausgang umdrehen, als er von der alten Frau
zurückgehalten wurde. Mit überraschend eisernem Griff
hielt sie seine Hand fest. Er spürte das Metall auf seiner
Handfläche.
„Es
wäre mir lieber, wenn Sie etwas Nahrhaftes für ihre
Tochter kauften.“ Alexander blickte die entschlossene Mutter
sanft an.
„Ich
verdanke Ihnen ihr Leben.“ Sie sah ihn eindringlich an.
„Beschämen Sie mich nicht, indem Sie mir die
Bezahlung verwehren.“
Der junge Mediziner
zögerte. Langsam setzte er sich seinen Hut auf das schwarze
Haar, das er nach der aktuellen Mode mit einer Samtschleife im Nacken
zusammengefasst trug. Er beschloss später noch einmal
vorbeizukommen – mit etwas Essbarem für seine magere
junge Patientin. Alexander verabschiedete sich höflich und
trat hinaus ins erste Sonnenlicht.
Die frische Luft war
eine Wohltat. Nach dem stickigen Mief in der feuchten Kellerwohnung war
ihm der vertraute Gestank der Wiener Gassen hochwillkommen. Die
Morgenluft war noch halbwegs erträglich, denn noch war es zu
früh für die unvermeidlichen Seen, die sich im Laufe
des Vormittags bilden würden, geformt aus den Inhalten von
unzähligen Nachttöpfen, die rücksichtslos
auf die Strasse geleert wurden. Offiziell war es schon seit mindestens
vier Jahren verboten, Unrat und unflättiges Wasser auf den
Gassen der Stadt zu entsorgen, doch den Wienern war es herzlich egal,
was die feinen Herren des Stadtrats beschlossen hatten. Warum auch
sollte man mit so lieb gewonnenen Traditionen brechen?
Alexander
lüftete kurz seinen Dreispitz und hievte sich die Ledertasche
quer über den Oberkörper. Der breite Lederriemen
verteilte das Gewicht seiner Ausstattung auf ein erträgliches
Maß. In Gedanken an seine unzähligen
Glasfläschchen und deren Inhalt beschloss er, über
den Hohen Marckt, den Licht Stög und den Haarmarckt nach Hause
zu gehen, um seine Vorräte bei der Pharmacie „Zum
König von Ungarn“, die nahe des Rothen Thurms
ansässig war, aufzufüllen. Es würde noch
eine Weile dauern, bis der ehrenwerte Apotheker Herr Spanfelder in Amt
und Würden sein würde, und Alexander schlug zuerst
den Weg zu einer Bäckerei ein, die für besonders gute
Milchbrötchen bekannt war. Schon jetzt klangen ihm die Ohren
von dem begeisterten Aufschrei, den Gabrielle und Marie zweifelsohne
von sich geben würden. Seine Schwestern waren kaum halb so alt
wie er und um ihr Wohlergehen sowie das seiner Mutter drehten sich
seine meisten Sorgen.
Der Andrang war
trotz der frühen Stunde beachtlich. Gelassen stellte sich der
Arzt mit aristokratischer Herkunft in die lange Reihe der Dienstboten,
die ausgeschickt worden waren, das Frühstück ihrer
Herrschaften, die zweifellos noch in ihren Betten ruhten, aufzubessern.
Die Geruchswolke von Schweiß und dem Gestank fauliger
Zähne versuchte er, so gut es ging, zu ignorieren.
Wahrscheinlich roch er zurzeit selber nicht besonders gut. Im Geiste
stellte sich Alexander eine Liste der Mittel zusammen, die er bei der
Pharmacie erwerben wollte. Die rundliche Bäckerin fertigte die
Menge routiniert ab und ließ sich dennoch die letzen
Neuigkeiten, die über den Ladentisch hinweg waberten, nicht
entgehen.
Zu wichtig war es,
zu wissen, welche hochwohlgeborene Dame in der vergangenen Nacht ihren
Ruf aufs Spiel gesetzt hatte oder welcher Baron zu betrunken gewesen
war, um in sein eigenes Bett zu finden. Beim Anblick des jungen Grafen
Eisenhardt verstummte die betriebsame Frau augenblicklich und verbiss
sich jeden weiteren Kommentar über die Laster der hohen
Herrschaften.
„Wie
geht es Eleonora?“, fragte eine junge Frau in
Dienstmädchenkleidung an Alexanders Seite. Der Ausdruck in
ihren
Augen ließ echte Besorgniserkennen.
„Sie hat
die Nacht gut überstanden.“ Der junge Arzt wandte
sich zu ihr. „Sind Sie mit meiner Patientin
verwandt?“
„Nein,
aber sie ist mir eine liebe Freundin.“ Ein
schüchternes Lächeln stahl sich auf das Gesicht der
Dienstmagd.
„Haben Sie
eine Möglichkeit, sie nachher zu
besuchen?“,erkundigte sich Alexander höflich.
Das Mädchen
überlegte kurz und nickte dann zustimmend. Augenblicklich
wandte er sich zur Bäckerin und ließ zwei
Weißbrötchen für Eleonora einpacken. Er
drückte sie der völlig verdutzten jungen Frau in die
Hand.
„Bitte
richten Sie Folgendes aus.“ Alexander sah ihr direkt in die
Augen. „In Suppe aufgeweicht, soll Eleonora das hier
über den Tag verteilt essen. Ich werde am Abend dann wieder
nach ihr sehen.“
Eleonoras Freundin
starrte ihr Gegenüber aus großen Augen an.
„Beweg
dich, Mädchen!“, herrschte sie die Bäckerin
an. „Geh’ schon und bedanke dich.“
„Vergelt’s
Gott, gnädiger Herr.“ Das Mädchen beeilte
sich, einen ehrerbietigen Knicks zu machen, und eilte aus der Backstube
hinaus.
In dem stickigen
kleinen Geschäft war es totenstill. Alexander spürte
sämtliche Blicke auf sich. Für einen kurzen Moment
kam er sich vor wie ein Aussätziger, der sich zur falschen
Zeit am falschen Ort befand. Erstaunt hob er die Augenbrauen und wandte
sich zur Frau hinter dem Ladentisch.
Nach seinem Einkauf
wollte Alexander in den Licht Stög abbiegen, als ihn
ein schroffer Befehl zusammenzucken ließ. Inbrünstig
hoffte er, dass ihn niemand beobachtet hatte und
nun als Feigling betrachtete. Aus sicherer Entfernung betrachtete er
den kleinen Trupp Soldaten seiner Allerhöchsten
Majestäten,
die den Karren begleiteten, der jeden Morgen durch die engen Gassen der
Hauptstadt fuhr – den Leichenkarren, um die
unzähligen
namenlosen Toten aufzulesen, die sich in den Wiener Gassen Nacht
für Nacht gesammelt hatten.
Vielleicht war
jemand unglücklich gestürzt, vielleicht war auch
jemand brutal überfallen worden, doch die meisten waren von
Hunger und Krankheit geschwächt elend zu Grunde gegangen
– und sie waren nicht etwa auf der Straße
gestorben. Die in Lumpen verhüllten Leichname waren von ihren
eigenen Familien in den Dreck gezerrt worden – von
Verwandten, die sich das Begräbnis nicht leisten konnten und
ihren Toten auf diese Weise einen Platz im Massengrab der Namenlosen
sicherten. Hätte seine Patientin Eleonora nicht
überlebt, hätte ihr ausgemergelter Körper
wahrscheinlich dasselbe Schicksal gehabt.
Der junge Arzt
verfolgte die groteske Szene. Ein Soldat half einem der Bestatter einen
Körper auf den Karren zu hieven. Ohne Respekt und bar jeder
Pietät warfen sie den Toten wie einen Sack Kartoffeln auf die
anderen Leiber.
In Freiberg war es
nicht anders gewesen. Während er blutverschmiert und am Rande
der eigenen Leistungsfähigkeit tagelang Verwundete versorgt
hatte, waren die Leichen derer, die das Massaker nicht
überlebt hatten, in ähnlicher Art und Weise entsorgt
worden. Eine sinnlose Verschwendung!Der junge Arzt hasste das
unnötige Blutvergießen, das zu nichts
führte als nur eine Unzahl von Witwen und Krüppeln
hervorzubringen, die zu einem elenden Dasein verdammt waren. Noch jetzt
dröhnten ihm die Schreie derjenigen Männer in den
Ohren, denen er ein Bein oder einen Arm amputieren musste –
meistens ohne Betäubung, weil dafür die Zeit oder die
Mittel fehlten. Nicht nur einmal war Alexander drauf und dran gewesen,
sich zu übergeben.
Der junge Mann
atmete einen Moment tief durch. Der Karren und die Soldaten waren fort.
Im Stillen sandte er ein Stoßgebet zum Himmel mit der Bitte,
dass es nach diesem Krieg nun eine längere Friedenszeit geben
würde. Für eine Weile würden ihm die vom
Württembergischen Regimentsschreiber auferlegten Dienste an
den Kriegsinvaliden im Nepomucenispital und in der Siechenanstalt
Bäckenhäusel völlig ausreichen. Unwillig
vergrub Alexander die Hände in den tiefen Taschen seiner
Jacke. Ein leichter Luftzug verriet ihm, dass er wieder vergessen
hatte, seine Mutter darum zu bitten, das Loch zu flicken.
Der Arzt sah an sich
herab. Der erste Eindruck konnte den mühsam gewahrten Anschein
wahrscheinlich bewahren, aber Alexander wusste es besser. Sein einziges
Paar Schuhe brauchte dringend neue Absätze, seine
Strümpfe verbrachten mehr Zeit auf dem heimischen
Stopfschwammerl als auf seinen Füssen, und der Stoff seiner
Jacke war an vielen Stellen fast durchgewetzt. In Momenten wie diesen
konnte er seinen Groll auf den Lauf des Schicksals kaum
unterdrücken und verfluchte alles, was mit Militär
und Staatsdienst zu tun hatte – die Einrichtungen, die seine
einst so wohlhabende Familie in die Armut gestürzt und ihn
durch das blanke Grauen geschickt hatten.
Eine leichte
Berührung am Ärmelaufschlag ließ ihn
aufsehen.
„Sind Sie
der Arzt Alexander?“, die Stimme eines kleinen
Mädchens piepste.
Der junge Mann
nickte – tief beschämt, denn das schmutzige
Geschöpf vor ihm hatte weder Strümpfe noch Schuhe an
den Füssen, dafür eine Menge offener Ekzeme.
„Können
Sie meiner Mutter helfen?“ In den Augen des Kindes waren
Unsicherheit, Angst und Hunger zu sehen.
„Ja. Wo
ist denn dein Zuhause?“, fragte er gutmütig und
versuchte seinem Gesicht einen milderen Ausdruck zu geben –
es gelang ihm auch, denn aller Groll war augenblicklich verflogen.
Alexander streckte
dem Mädchen seine große Hand aus. Das verschreckte
Kind zögerte einen Moment,doch legte es dann vertrauensselig
sein schmutziges Händchen in seine Handfläche. Der
junge Arzt drückte es sanft.
„Wie
heißt du?“, fragte er höflich und deutete,
dass die Kleine die Führung übernehmen sollte.
„Elisabeth
Kramer.“, antwortete sie artig. „Doch alle nennen
mich Lisi.“
„Deine
Familie und deine Freunde?“
„Ja.“
„Darf ich
dich auch so nennen?“ Alexander hob wichtig seine Augenbrauen.
Augenblicklich
entblößte Elisabeth eine Reihe brauner kleiner
Zähne mit etlichen Lücken und strahlte ihn an. Der
Arzt seufzte. Das Kind war noch keine acht Jahre alt.
|